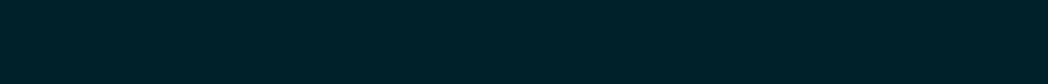Ab Mittwoch duellieren sich Europas beste Fußballerinnen in der Schweiz nicht nur um den EM-Titel, sondern auch um jede Menge Geld - so viel wie noch nie zuvor. 41 Millionen Euro schüttet die Europäische Fußball-Union (UEFA) an die Starter aus – und auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) legt mit einer Rekordprämie nach: Im Falle eines Titelgewinns winken Kapitänin Giulia Gwinn und ihren Kolleginnen jeweils 120.000 Euro, doppelt so viel wie beim EM-Turnier vor drei Jahren.
Es sind beeindruckende Summen, die die gewachsene Bedeutung des Frauenfußballs unterstreichen. Aber: Von "Equal Pay" ist man - mit wenigen Ausnahmen - noch weit entfernt. Bei der Männer-EM 2024 etwa hätte der Titel jedem deutschen Nationalspieler 400.000 Euro eingebracht. Die DFB-Frauen zeigten sich ob der verdoppelten Prämie dennoch "zufrieden".
DFB-Prämien im Vergleich zur letzten EM teilweise verdreifacht
Zum Vergleich: Englands Fußballerinnen bekämen für die Titelverteidigung umgerechnet etwa 85.000 Euro. "Ganz, ganz positiv für uns war, dass das erste Angebot des DFB unseren Vorstellungen schon sehr, sehr nahe kam. Also gab es gar keine langen Verhandlungen", sagte Gwinn im kicker über die leistungsbezogene DFB-Prämie.
Konkret fließt erst ab dem Erreichen der K.o.-Runde Geld auf die Konten der Nationalspielerinnen. Das Viertelfinale bringt 45.000 Euro, das Halbfinale 65.000 Euro und die Finalteilnahme wird mit 90.000 Euro belohnt. Damit ist der Einzug ins Endspiel dreimal so viel Wert wie 2022. Damals erhielt jede Spielerin 30.000 Euro für den Vize-Titel. "Die Entwicklung des Frauenfußballs auf allen Ebenen genießt beim DFB höchste Priorität. Wir brauchen eine nachhaltige Entwicklung der Strukturen und Bedingungen", betonte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.
Auch die UEFA will den Frauenfußball weiter fördern und hat sich vorgenommen, zwischen 2024 und 2030 eine Milliarde Euro zu investieren. Für das Turnier in der Schweiz steigerte sie ihre Ausschüttung von 16 Millionen auf 41 Millionen Euro. Insgesamt ist dies allerdings nur ein Achtel der 331 Millionen Euro Preisgeld bei der Männer-EM. Das maximale Gesamtpreisgeld für die Europameisterinnen beträgt rund fünf Millionen Euro, statt etwa 28 Millionen Euro bei den Männern im vergangenen Sommer.
UEFA macht mit Frauen-EM ein Minusgeschäft
"Es gibt kein Sportevent auf der Welt, wo es ein derartiges prozentuales Wachstum gibt. Es ist ein großes Statement", sagte Nadine Keßler, UEFA-Direktorin für Frauenfußball. Für den Dachverband sei das Turnier anders als bei den Männern allerdings ein Minusgeschäft: "Es geht uns nicht darum, dass wir mit der Euro Geld machen wollen. Die Euro der Frauen wird für die UEFA einen Nettoverlust von 20 bis 25 Millionen Euro bringen", so Keßler.
"Equal Pay" bleibt trotz der enormen Entwicklung des Frauenfußballs vorerst ohnehin die Ausnahme: Der norwegische Fußballverband hatte 2017 seine Zahlungen angeglichen, auch weil die Männer auf Geld verzichteten. Der Schweizer Verband hat im vergangenen Jahr "sämtliche partnerbezogenen Erfolgsprämien" angeglichen, mit Hilfe eines Sponsors.
Der Traum von gleicher Bezahlung ist ohne Zugeständnisse Dritter derzeit noch nicht möglich, zu weit sind die männlichen Kollegen mit ihren Millionenverträgen enteilt. Eine Bundesligaspielerin verdiente in der abgelaufenen Spielzeit im Schnitt rund 4000 Euro. "Ein Mindestgrundgehalt sollte eine Voraussetzung sein, damit die Spielerinnen der Arbeit als Fußballerin nachgehen können und nebenbei nicht noch 40 Stunden arbeiten müssen", sagte Bayern Münchens Direktorin Bianca Rech.
Der Weg zur Gleichstellung ist noch lang.